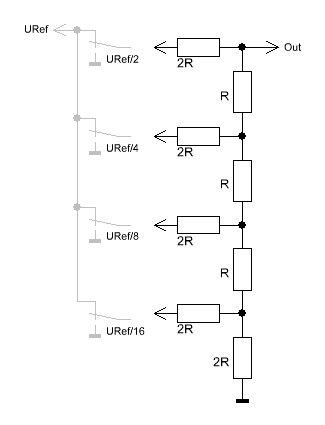 Durch
ein R2R-Netzwerk ist es möglich, einen Binärwert in einen analogen Wert
umzuwandeln. Hierzu wird das nebenstehende Netzwerk an die Binärausgänge
angeschlossen. Durch
ein R2R-Netzwerk ist es möglich, einen Binärwert in einen analogen Wert
umzuwandeln. Hierzu wird das nebenstehende Netzwerk an die Binärausgänge
angeschlossen.Hier erkennt man
auch, woher die Bezeichnung R2R kommt. Die Widerstände, die an die
Binärausgänge gehen, haben den doppelten Wert, wie die
'Querwiderstände'.
Werden an alle Eingänge ein '0'-Signal
angelegt, also mit GND verbunden, ist die Ausgangsspannung an 'Out' auch
0V. Legt man am unteren Anschluss nun z.B. die Referenzspannung von 10V
an, ergibt sich am Ausgang eine Spannung von URef/16, also in unserem
Beispiel 0,625V. Die Referenzspannung an URef/8 ergibt am Ausgang 1,25V.
Eine '1', also die Referenzspannung an URef/4 hat eine Spannung von 2,5V
zur Folge und am oberen Anschluss ergibt URef 0,5V am Ausgang.
Möchte man andere Spannungen am Ausgang
haben, muss man nur die entsprechende R2R-Eingänge mit der
Referenzspannung versorgen. Die nicht benötigten Eingänge müssen
zwingend auf GND geschaltet werden.
Hierdurch lassen sich am Ausgang
Spannungen von 0V bis URef-URef/16 in Schritten von URef/16 erzeugen.
Leider wird hier nie die volle Referenzspannung erreicht. Dies kann man
durch nachschalten eines Verstärkers ausgleichen.
Soll die Spannungsstufung weiter
verfeinert werden, muss man nur weitere R2R-Glieder hinzufügen. Bei
einem weiteren Glied hätten wir schon eine Auflösung von 0,3125V. |